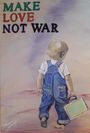Die Universitäten Bremen, Hildesheim und die Freie Universität Berlin (FU) sehen sich mit schweren Vorwürfen im Umgang mit antisemitischen Vorfällen konfrontiert. Während an der Universität Bremen wiederholt antisemitische Aktionen und Äußerungen öffentlich wurden, sorgen in Hildesheim die Störung einer Lehrveranstaltung durch eine palästinensische Gruppe und in Berlin die Absage einer Ausstellung über antisemitische Pogrome an der FU für Kritik. Betroffene und Experten mahnen schärfere Reaktionen an und fordern grundlegende Änderungen im Umgang mit Antisemitismus auf dem Campus.
Antisemitismus an der Universität Bremen
„Man merkt, dass israelbezogener Antisemitismus gängig ist und vollkommen normalisiert wird. Und man merkt, dass in den Forderungen, die diese Gruppen stellen, Weichen gelegt werden für eine Judenverfolgung“, erzählt Mark Rozanov dem Magazin buten und binnen. Rozanov studiert an der Uni Bremen, wo er sich nicht mehr sicher fühle, weil er Jude ist.
Die Gruppen, von denen Rozanov spricht, sind pro-palästinensisch, die jüdische bzw. „zionistische“ Studierende an der Uni mit antizionistischen Stickern, Graffiti und Besetzungen einzuschüchtern versuchen. Das gelingt ihnen umso besser, je tatenloser die Universitätsleitung auf die Vorkommnisse reagiert. Das kritisiert nicht nur Rozanov, sondern auch das Bremer Bündnis gegen Antisemitismus - erneut.
Es hatte bereits im Juni einen offenen Brief an die Universitätsleitung geschickt, in dem es antisemitische Vorfälle dokumentiert und die Verantwortlichen der Uni zum Handeln auffordert. Der Brief legt u.a. dar, dass bei der pro-palästinensischen Besetzung des Campus am 8. Mai von der Gruppe „Uni(te) for Pali“ antisemitische Positionen propagiert wurden und Israel das Existenzrecht abgesprochen wurde. Auf Transparenten wurde das von der Hamas zur Feindmarkierung genutzte rote Dreieck gezeigt - ein Symbol, das inzwischen in Deutschland verboten ist, da es auf eine Morddrohung hinausläuft.
Das Rektorat habe das Protestcamp zwar geräumt, aber den „offenen Antisemitismus der Akteure“ verharmlost. Auf die im Brief formulierte Kritik habe die Universitätsleitung weder reagiert, noch sei sie ins Handeln gekommen, „um die antisemitische Agitation auf dem Campus zu stoppen.“ Infolgedessen hätten die antisemitischen Vorfälle an der Universität Bremen weiter zugenommen, wie das Bündnis nun in einem zweiten Brief kritisiert. Hierzu verweist es auf die Orientierungswoche im Oktober. Laut Brief verteilte der Muslimische Hochschulbund Bremen Anstecker, die eine Landkarte ohne Israel zeigten, und rief damit indirekt zur Delegitimierung des jüdischen Staates auf. Die Gruppe „Uni(te) for Pali“ organisierte Veranstaltungen, bei denen Israel als „genozidales Apartheidsystem“ dargestellt wurde, und wurde sogar auf universitären Konferenzen als Sprecher eingeladen.
Der Brief dokumentiert zudem neue antizionistische Graffiti und Aufkleber auf dem Campus, die Parolen wie „Destroy Israel“ und Solidaritätsbekundungen mit der antisemitischen Gruppe Samidoun zeigen. Die Universitätsleitung lasse diese Darstellungen oft monatelang unkommentiert stehen, was bei jüdischen Studierenden wie Rozanov den Eindruck erzeuge, dass die Universitätsführung diese Drohkulisse nicht ernst nehme.
Es braucht mehr Sicherheit
Das Bremer Bündnis stellt in ihrem Brief Forderungen an die Universitätsleitung. Die Universitätsleitung müsse öffentlich Stellung beziehen und die antisemitischen Vorfälle klar verurteilen. Gruppen wie „Uni(te) for Pali“ und der Muslimische Hochschulbund müssten hinsichtlich ihrer Aktivitäten und Ideologien überprüft werden und Veranstaltungen mit antisemitischem Inhalt dürften auf dem Campus keinen Platz mehr haben.
Zudem benötige der Campus eine geschulte Sicherheitsinfrastruktur, um die Sicherheit jüdischer Studierender zu gewährleisten. Dazu gehöre auch eine Melde- und Beratungsstelle und ein Antisemitismusbeauftragter.
Mit einem vom Rektorat gegenüber buten und binnen betonten, nach allen Seiten hin „offenen Diskurs, der unterschiedliche Meinungen zulässt und willkommen heißt“, würden Jüdinnen und Juden auf dem Campus nicht aktiv geschützt. Dabei stehen Universitäten in Deutschland in der Pflicht, jüdisches Leben zu schützen.
Antisemitische Gewaltakte gegen Meinungsfreiheit
Diese Pflicht betont auch der Niedersächsische Landesbeauftragte gegen Antisemitismus, Dr. Gerhard Wegner, in Richtung Universität Hildesheim. Hier wurde eine Lehrveranstaltung durch eine palästinensische Gruppe massiv gestört, die offen antisemitische Positionen propagierte. Wegner verurteilt die Vorfälle scharf: „Antisemitische Aktionen verbreiten ein Klima der Angst, in dem jüdische Studierende sich nicht mehr sicher fühlen können.“ Wegner fordert wie das Bremer Bündnis die Einführung von Antisemitismusbeauftragten an niedersächsischen Hochschulen sowie strengere universitäre Disziplinarregelungen. „Die Unterbindung freier Diskussionen durch antisemitische Aktionen ist ein Gewaltakt und gefährdet die Meinungsfreiheit“, warnt Dr. Wegner.
Die Universität fiel bereits 2016 damit auf, dass ihre damalige Lehrbeauftragte Ibtissam Köhler antijüdische Propaganda verbreiten konnte und ihre Präsidentin Christine Dienel auf die öffentliche Kritik mit Abwehr reagierte.
Als einen „Gewaltakt gegen die Meinungsfreiheit“ lässt sich auch die Verhinderung einer Ausstellung über antisemitische Pogrome an der FU durch die Universitätsleitung bewerten. Mit dem historischen Institut war die Wanderausstellung „The Vicious Circle“ des britischen National Holocaust Centre and Museum geplant, die anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz im Friedrich-Meinecke-Institut gezeigt werden sollte. Die Ausstellung zeigt Schauplätze von Pogromen in Europa und dem Nahen Osten. Die Universitätsleitung lehnte die Ausstellung aber dann ab: Sie könne die Besucher „emotional stark involvieren und vor Ort intensive Debatten auslösen, die möglicherweise unangemessen sind“, wie das Präsidium der FAZ auf Nachfrage mitgeteilt hat.
Für Thomas Thiel, der diesen Vorfall in der FAZ kommentiert, klingt das nach einer fadenscheinigen Ausrede. Zum einen könnte man mit diesem Argument jede Holocaust-Erinnerung und jede ideologisch wie emotional aufgeladene Debatte aus der Hochschulöffentlichkeit verbannen. Zum anderen: Warum wird die Ausstellung nicht verlegt? Dass sie Zielscheibe von Vandalismus werden könnte, sei eine berechtigte Annahme. Doch dann lasse man sich den Schutz der Ausstellung und den von der Uni proklamierten Willen, die Bildung über jüdisches Leben zu fördern, halt etwas kosten. Immerhin habe man Ende November auch eine pro-palästinensische Demonstration unter massivem Polizeiaufgebot - trotz der Zerstörung von Uniräumen und -mobiliar in der Vergangenheit - stattfinden lassen.
Universitäten in der Verantwortung
Die Vorfälle in Bremen, Hildesheim und Berlin, denen sich weitere an den Unis Leipzig und Freiburg, wo Veranstaltungen mit dem israelischen Historiker Benny Morris und dem Sozialphilosophen Ingo Elbe gecancelt wurden, zeigen ein Muster: Hochschulleitungen nehmen gegenüber antizionistischen Aktivisten eine vorauseilende Defensivhaltung ein. Dass Denken und Widerspruch zusammenhängen ist von Verantwortlichen in den Institutionen des Geistes offensichtlich verdrängt worden. Der Umgang der Universitätsleitungen mit antisemitischen Vorfällen ist von einer erschreckenden Passivität geprägt, die einer schleichenden Normalisierung gleichkommt und antisemitischer Radikalisierung Legitimität verschafft. Die Universität wird so für jüdische Studierende von einem Raum freier Entfaltung in einen der Einschüchterung und Angst verwandelt. Solches konfliktscheue Verhalten beweist einmal mehr, dass die Lehren, die an deutschen Universitäten aus der Geschichte gezogen werden, keinen Imperativ zum Handeln begründen, wenn es darauf ankommt, sondern lediglich zum hohlen Pathos für schlechte Reden an Gedenktagen dienen. Statt klare Kante gegen Antisemitismus zu zeigen und jüdisches Leben aktiv zu schützen, verstecken sich die Verantwortlichen hinter falscher Rücksicht auf Emotionen, die Gegenstand einer Debatte zu sein hätten, und einen „offenen Diskurs“, der für jüdische Perspektiven wenig und für israelische keinen Raum bietet. Anstatt Verantwortung zu übernehmen, kapitulieren Universitäten offensichtlich vor antisemitischen Vandalen und lassen jüdische Studierende mit ihnen allein.