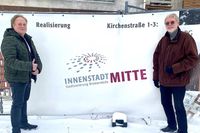Werbefinanzierter Lokaljournalismus hat es schwer. Seit der Pandemie sind die Auflagen um 40 Prozent eingebrochen, die Seitenzahlen schrumpfen, und die Politik legt ihm symbolpolitische Steine in den Weg: etwa mit der angedachten Opt-in-Regelung oder dem geplanten Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel. Dabei kann niemand plausibel erklären, wie gedruckte Süßigkeitenwerbung Kinder dick machen soll, die Prospekte ohnehin nicht lesen.
Um dieses drohende Finanzierungsfiasko abzuwenden, fordert der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter seit Langem eine staatliche Förderung der Zustellinfrastruktur. Diese Forderung aber verhallt bisher ungehört. Auch der Nachdruck darauf, dass kostenlose Wochenblätter Partner des lokalen Handels sind, die zugleich gegen Desinformation und rechte Agitation kämpfen – also die Demokratie retten würden –, hat bislang kein Handeln bewirkt.
Damit lässt sich auf ein weiteres Problem schließen, mit dem Wochenblätter zu kämpfen haben: Ihre Inhalte – abseits von Werbung und Servicethemen – werden nicht ernst genommen. Was bedeutet schon der Schützenballkönig gegen das Sterben von Zivilisten in der Ukraine? Was zählt der Abschied eines sympathischen Schulhausmeisters oder einer beliebten Schulleiterin, wenn Putin Europa mit Krieg bedroht? Was bedeutet der Kunsthandwerkermarkt, wenn der Weltmarkt den Bach runtergeht?
Es sind diese, vor dem Weltgeschehen klein erscheinenden Geschichten der Wochenblätter, weshalb sie belächelt oder gar als Käseblatt verachtet werden. Und ich bin ganz ehrlich: Sowohl in meinem Umfeld für große Zeitungen oder Bücher schreibender Menschen als auch von mir wurde meine Tätigkeit beim ANZEIGER anfänglich mit einem despektierlichen „ganz nett“ quittiert. Denn es lässt sich durchaus mit Berechtigung hinterfragen, inwieweit der Kaninchenzüchterverein nerdige Zerstreuung und Ort der Geselligkeit gegen gesellschaftlich bedingte Vereinsamung ist – oder mehr ein Symptom der leidvollen Resignation vor einer Welt, die den Menschen nicht mehr zu bieten hat als die Identifikation mit Kaninchen, die man wahlweise in Käfigen hält oder beim Rammeln beobachtet.
Auch ist es ideologisch problematisch, wenn ein Medium vor allem „Menschengeschichten“ bringt, während die Einrichtung der Welt ihnen verwehrt, Geschichte zu schreiben. Wenn jede zweite Story im versöhnlichen Ton „Gemeinschaftsleistungen“ betont, die zugleich aber die Ökonomisierung der menschlichen Beziehungen vor Ort vorantreiben – wenn also das Wochenblatt den Blick in den gesellschaftlichen Abgrund verstellt.
Aber – und das ist ein fettes Aber: Der Reflex, der den konservativen Großkotz und das linke Großmaul auf die kleinen Geschichten der Menschen in ihrem gesellschaftlich eingeschrumpften Wirkungskreis herabblicken lässt, bloß weil sie klein und unbedeutend sind, ist weitaus schlimmer als der Impuls, sein Leiden an der Welt beim Streicheln von Kaninchen zu vergessen. Denn in der Verachtung des Kleinen und Überflüssigen drückt sich nicht nur ein kulturloser, provinzieller Geist aus, der bloß auf Selbstbestätigung aus und blind ist für Widersprüche, die gute „Menschengeschichten“ zumindest erfahrbar machen.
Die Verachtung des Kleinen und Überflüssigen drückt einen Hang zum Großen aus – bloß weil es groß ist. Und damit die Affirmation der barbarischen Substanz einer Gesellschaft, in der Bedeutung nicht dem Ephemeren, Besonderen und Zerbrechlichen, sondern nur dem um diese Eigenschaften beschnittenen Verwertbaren zukommt. Wer das Kleine lächerlich macht, betreibt das Geschäft der großen Vernichtung.
Das Wochenblatt ist eine Zumutung – und zwar für das verallgemeinerte Bewusstsein des Viehzüchters, das nur dem Beachtung schenkt, was Gewicht auf die Waage des Werts bringt.
Darüber hinaus: Der Glaube an das Große - den Weltgeist war stets der Steigbügelhalter des Schrecklichen. Der Hang zum Wichtigen, der Wille zur historischen Größe, das Pathos der Maßstäbe – Eigenschaften des autoritären Charakters. Wer den Kaninchenzüchter belächelt und stets nur auf das Große schielt, auf den historischen Moment, auf die große Bühne, wird keine Hemmungen kennen, für den in einen Weltkrieg umgeschlagenen Weltmarkt zu massakrieren. Großes zu wollen ist nicht von vornherein falsch – aber das bloß Große zu lieben, ist stets gefährlich gewesen für das Individuum, das einzelne, zerbrechliche Leben, das das Wochenblatt verteidigt – gegen den Weltlauf und seine Exekutoren.
Am Tag der Pressefreiheit ist es daher an der Zeit, die Verteidiger der kleinen Dinge zu würdigen: die Redakteurinnen und Redakteure, die sich nicht zu fein sind, Vereinsberichte zu schreiben, Geburtstage zu notieren oder Hausmeister zu würdigen. Sie sind die Letzten, die sich nicht schämen müssen, wenn die große Geschichte wieder einmal über die Menschen hinwegrollt.