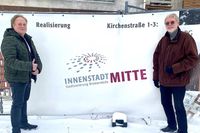(pvio). Nach dem Mord an George Floyd durch den Polizisten Derek Chauvin wird auch in Deutschland gegen Rassismus demonstriert und über ihn eine gesellschaftliche Debatte geführt. Der ANZEIGER hat mit Ellen Twumasi über ihre Erfahrungen mit Rassismus, entwertende Denkkategorien und „weiße Privilegien“ gesprochen.
ANZEIGER: Frau Twumasi, wo sind Sie aufgewachsen?
Twumasi: Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen.
ANZEIGER: Und Ihre Eltern?
Twumasi: Meine Mutter ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Mein Vater in Ghana und ist dann im Studium nach Deutschland gekommen und hat da meine Mutter kennengelernt.
ANZEIGER: Wann haben Sie das erste Mal Erfahrung mit Rassismus gemacht?
Twumasi: Das war in der Grundschule, in der ersten oder zweiten Klasse. Ich war damals das einzige Mädchen mit dunkler Haut in der Klasse - ich selber habe das gar nicht wahrgenommen. Das fällt dir erst auf, wenn dir das entgegengebracht wird. So wurde mir das erste Mal klar, dass ich irgendwie anders betrachtet werde, als ein Junge mich beim Rennen auf dem Schulhof als „Affe“ bezeichnete. Ich weiß noch, wie mich das richtig durchzuckt hat im ganzen Körper, weil ich wusste, dass der Junge etwas sehr Böses zu mir gesagt hat. Nur wusste ich nicht genau, warum. Jetzt ist mir natürlich klar, dass der Junge mich in Bezug auf meine Hautfarbe abwerten wollte. Das war einschneidend, dieses Erlebnis.
ANZEIGER: Blieb es bei dieser einen negativen Erfahrung in der Kindheit?
Twumasi: Nein, ich habe in meinem ganzen bisherigen Leben immer wieder Erfahrungen mit Rassismus machen müssen.
ANZEIGER: Sie sagen, Sie haben die unterschiedlichen Hautfarben erst gar nicht wahrgenommen. Woher kommt dann eine solche abwertende Wahrnehmung Ihrer Hautfarbe wie bei dem Jungen?
Twumasi: Ich denke, das übernehmen Kinder von den Eltern und auch aus den Medien. Man kann z. B. sich anschauen, wie Schwarze schon immer in Karikaturen oder Filmen dargestellt wurden. Auch wenn sich in der Filmbranche derzeit einiges zum Positiven verändert: In den meisten bisher produzierten Filmen ist der Hauptdarsteller meistens ein weißer, männlicher Held. Der Bösewicht, der Unwichtige oder die Lachnummer ist ein Schwarzer. Diese Repräsentationen tragen sicherlich dazu bei, dass Kinder solche Bilder entwickeln. Ich erinnere mich auch an das Spiel: „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“ Diese Frage muss man sich wirklich mal stellen.
ANZEIGER: Und denken Sie, dass die Wahrnehmung von Hautfarben gesellschaftlich konstruiert ist?
Twumasi: Definitiv. Das erkennt man bereits an der Rede von der klaren Gegenüberstellung von Schwarz und Weiß, während in Wirklichkeit die Hautfarben auf einer Bandbreite von Nuancen angesiedelt sind und die Einteilung überhaupt nicht so eindeutig möglich ist, wie die Kategorien es nahelegen. Mein Hautton liegt zum Beispiel auf dieser Farbskala zwischen Schwarz und Weiß, eher bei Mittelbraun, ich werde aber aufgrund der starren Kategorisierung als schwarz wahrgenommen.
ANZEIGER: Wann ist für Sie ein Verhalten oder eine Aussage rassistisch?
Twumasi: Wenn jemand mich aufgrund meiner Hautfarbe abwertet. Ich würde da aber auch differenzieren: Es gibt Aussagen, die sind zwar abwertend und rassistisch, aber die Person will mich damit nicht abwerten, sondern macht vielleicht nur einen Denkfehler. Dann gibt es Aussagen, die darauf abzielen, mich abzuwerten, in dem man mich z. B. mit dem berühmten N-Wort beschimpft. Was ich auch bereits erlebt habe, als ich beispielsweise nur auf den Bus gewartet habe oder auch im Verkehr. Da hat es in einer Situation gereicht, dass ich an einer grünen Ampel beim Losfahren zögerte, dass der Fahrer hinter mir sich neben mich stellte, sein Fenster runterkurbelte und mich mit dem N-Wort betitelte. In so einer Situation sehe ich ganz klar: Jemand möchte mich rassistisch beleidigen, sprich abwerten und erniedrigen. Ich bekomme aber auch positiven Rassismus zu spüren, wenn man zu mir sagt: Ich wollte schon immer mal eine farbige Freundin haben. Man könnte sagen, das ist doch ganz charmant, aber nein. Denn diese Person denkt, dass ich eine ganz andere Kategorie von Frau bin; dass ich dadurch, dass meine Haut dunkler ist, ich kategorisch anders wäre als eine weiße Frau. Das ist für mich auch Rassismus. Weil auch hier von meiner Hautfarbe, von einem bloß optischen Merkmal, auf mein Verhalten geschlossen wird. Dass ich aufgrund meiner Haut exotisch, temperamentvoll oder wie auch immer sei, ganz egal, wie ich mich verhalte.
ANZEIGER: Weil man Sie dann nur als bloße Repräsentantin einer Gruppe wahrnimmt?
Twumasi: Genau, wodurch ich mich auch abgewertet fühle, weil ich nicht als Person oder aufgrund meines Charakters wahrgenommen werde, sondern nur als ‚eine von denen‘.
ANZEIGER: Im Zuge der Ermordung von George Floyd wird auch hierzulande viel über weiße Privilegien gesprochen. Was sind Ihres Erachtens weiße Privilegien?
Twumasi: Wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem telefonieren würde, dann würde mein Gesprächspartner, weil deutsch ja meine Muttersprache ist, nicht die Kategorie „schwarzer Mensch“ aufmachen und alle dazugehörigen Vorstellungen abrufen, sondern wahrscheinlich erst mal gar keine. In dem Moment nutze ich dann selbst das weiße Privileg, weil keine Vorerwartungen an mich gestellt werden und, was noch wichtiger ist, man betrachtet mich dann nicht als Teil einer Gruppe.
ANZEIGER: Privilegiertes Weißsein bedeutet also, dass man nicht aufgrund seines Aussehens negativ kategorisiert wird?
Twumasi: Ja, aber nicht nur. Daraus folgen auch sehr viele konkrete Vorteile für Weiße, zum Beispiel, dass ihnen eher vertraut wird und sie dann leichter eine Wohnung oder eine Arbeit bekommen, was wiederum ihre gesellschaftliche Position noch mehr stärkt.
Ein Beispiel: Sieht eine weiße Person eine Gruppe von drei Weißen und einer von ihnen geht z. B. bei Rot über die Ampel, würde die weiße Person nicht sagen: „Diese Weißen schon wieder. Können sich nicht an die Regeln halten und gehen immer bei Rot über die Straße.“ Das wird nicht gesagt, weil aufgrund der gleichen Hautfarbe keine Vorerwartungen und Vorurteile aktiviert werden. Bei schwarzen Menschen hingegen schon. Das heißt auch, dass ich mir stets Gedanken machen muss, dass aufgrund meines Verhaltens nicht auch alle anderen mit meiner Hautfarbe abgestempelt werden. Das müssen Weiße in dieser Gesellschaft auch nicht, ihr Weißsein wird nicht als Merkmal hervorgehoben. So kann das öffentliche Ansehen von Weißen auch nicht beschädigt werden. - Das ist schon ein Privileg, nur als Einzelperson abgestempelt zu werden. Nach dem Mord an George Floyd hat ja niemand gesagt: ‚Die Weißen sind brutal oder Mörder.‘
Das zu tun, wäre im Übrigen definitiv auch problematisch. Denn auch hier ist es so, dass nicht die Hautfarbe des Polizisten dazu geführt hat, dass er George Floyd getötet hat.
ANZEIGER: Wie könnte man denn so eine Tat erklären?
Twumasi: Zumindest nicht aufgrund eines optischen Merkmals. Um so eine Tat zu erklären, muss man sich unheimlich viele Faktoren anschauen, wie die soziale Schicht, das Geschlecht, die finanzielle Lage, das Elternhaus, psychische Krankheiten. Man sollte es sich dabei auf keinen Fall zu einfach machen.
ANZEIGER: Was erhoffen Sie sich von der aktuell geführten Debatte über Rassismus hierzulande?
Twumasi: Dass immer mehr Menschen begreifen, dass Rassismus ein alltägliches Problem ist und nicht nur eines der amerikanischen Polizei; dass sie verstehen, dass zu seiner Bekämpfung soziale und politische Veränderungen gehören. Eine Polizeireform, eine bessere Schulung von Polizisten im Umgang mit Konflikten und eine bessere Prüfung ihrer Motive, Polizist zu werden, wäre nur ein Anfang. Unerlässlich ist, dass z. B. Stadtviertel aufgewertet werden, um Kriminalität an der Ursache und nicht bloß mit bewaffneten Polizisten zu bekämpfen oder dass mehr Geld in Bildung fließt, um den Menschen die Chance zu geben, gesellschaftlich aufzusteigen. Auf persönlicher Ebene ist es nötig, dass Menschen sich gegenseitig differenzierter wahrnehmen. Vielleicht hat mein Gegenüber eine andere Optik, ist aber genau wie ich Akademiker/Arbeiter, Teenager/Rentner, Frau/Mann, Vater/Mutter. Auf diese Weise findet man gemeinsame Anknüpfungspunkte.
Darüber hinaus wäre es gut, wenn gleichzeitig die Leute - weiße aber auch schwarze, oder braune, egal welche Hautfarbe - aufhörten, andere Menschen abwertend zu kategorisieren und anfingen, einander als Individuen zu betrachten und sich aufgrund ihres Charakters bewerten.
Ellen Twumasi ist 35 Jahre alt und Lehrerin für Spanisch und Englisch an einer berufsbildenden Schule in Bremerhaven.