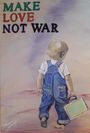Am Muttertag wird gefeiert, was Frauen täglich leisten – und gleichzeitig zementiert, was sie nicht sein dürfen: frei. Warum die Gleichberechtigung in der Familie an unbewussten Grenzen scheitert und was Männer wirklich tun könnten, erklärt Patrick Viol.
Kein Bohrinseljob, kein Schichtsystem im Hochofen, keine Nahkampfausbildung bei der Bundeswehr ist so unbarmherzig wie das Leben einer Mutter, die – nachdem der Nachwuchs während seiner intrauterinen Entwicklung den Körper seiner Wirtin massiv beschädigt hat – jeden Tag körperlich, psychisch und geistig ohne Pause auf Abruf funktioniert. Mit einer Opferbereitschaft, die kein Mann ohne artikuliertes oder unbewusstes Selbstmitleid aufzubringen imstande wäre. Das bestätigen nicht wenige Vaterratgeber. Sie warnen Väter davor, in den ersten Jahren nach der Geburt, ihre Frauen zusätzlich damit zu behelligen, dass sie sich zu wenig gesehen und geliebt fühlen.
Der Mann – bzw. Vater –, der behauptet, Vaterschaft sei der Mutterschaft hinsichtlich Arbeits- und Verzichtsausmaß gleichwertig, beweist seine Empathieunfähigkeit gegenüber seiner Partnerin und verrät ungewollt seinen Neid: auf die Potenz im wortwörtlichen Sinn, auf die Fähigkeit, Leben zu erschaffen, es zu gebären, lebensbedrohliche Schmerzen dabei auszuhalten und es zu nähren. Auf den existenziellen Kampf mit der Natur, den Männer in Romanen, Wissenschaft oder Eso-Survivalcamps nur mühsam nachinszenieren können. Und doch – genau hier beginnt das Problem.
Stärke als Zumutung
Diese übermenschliche Stärke, das Gewicht neuen Lebens ohne Mucken zu tragen, ist keine Gabe. Sie ist eine gesellschaftlich erzwungene Anpassungsleistung. Eine, die Glück und Lebenszeit raubt. So haben verheiratete Frauen mittleren Alters ein höheres Risiko für psychische und physische Krankheiten und sind weniger glücklich als ledige Frauen. Bei Männern verhält es sich umgekehrt.
Auch wenn der Patriarch, der früher nach Hause kam und sich in den Sessel fallen ließ, heute bestenfalls noch eine historische Karikatur ist, bleibt seine Schattenfigur in den Routinen der Gegenwart wirksam.
Wunsch und Wirklichkeit
Männer wollen zwar inzwischen mehr Care-Arbeit leisten – so sagt es der Väterreport 2023. Rund 50 Prozent wünschen sich eine gleichmäßige Aufteilung – doch nur 21 Prozent der Paare leben sie tatsächlich. Auch in der Elternzeit zeigt sich die Diskrepanz: 70 Prozent der Frauen, aber nur knapp 30 Prozent der Männer nehmen Elternzeit. Mütter im Schnitt 14 Monate, Väter weniger als vier.
Selbst wenn beide Eltern berufstätig sind, bleibt der Löwenanteil der Sorgearbeit bei den Frauen – fast 80 Minuten mehr täglich. Und beim Mental Load, der Organisation von Sorgearbeit im Alltag, tragen weiterhin Frauen den Bärenanteil. Nur 33 Prozent der Frauen sehen hier eine gleichberechtigte Arbeitsteilung.
Alte Bilder im neuen Gewand
Daran trägt nicht nur die Politik Schuld: mangelnde Kita-Plätze, Ehegattensplitting, Gender Pay Gap. Es liegt auch an den Überzeugungen der Menschen. Laut einer YouGov-Umfrage glauben 37 Prozent der Deutschen, dass es für ein Kind am besten sei, wenn die Mutter zu Hause bleibt. Nur ein Prozent hält es für besser, wenn der Vater daheim ist. In einer Schweizer Umfrage meinten 34 Prozent der Befragten, Frauen seien grundsätzlich besser für Kinderbetreuung geeignet.
Was als Respekt getarnt ist, ist oft Bequemlichkeit – und Ausdruck eines unterschwelligen Rollenbilds, das sich hartnäckig hält. Aber warum?
Verleiblichte Rückfälle
Die Antwort beginnt mit einem Blick auf die Bilddatenbank Adobe Stock. Wer „Muttertag“ eingibt, bekommt rosa Herzen, Blumen, gebastelte Karten. Zärtlichkeit, Fürsorge, Dankbarkeit – alles in Pastelltönen. Mütter als Wesen, die sich aufopfern und dafür ein Kinderlächeln zurückbekommen. Gibt man hingegen „Vatertag“ ein, erscheinen Bollerwagen, Bier, Superhelden – Väter als Grenzüberschreiter, die aus der Rolle ausbrechen dürfen, weil es „ihre Natur“ verlangt. Die Mutter wird ins Heimelige eingerahmt, der Vater in die Welt entlassen.
Was nach Marketingästhetik aussieht, verweist auf tieferliegende Strukturen, die von der Bildsprache reproduziert werden. Der Sozialpsychologe Sebastian Winter beschreibt das so: Auch wenn viele Männer heute moderne Ansprüche an sich formulieren – Verantwortung übernehmen, Windeln wechseln, präsent sein wollen –, reagieren sie ab der Geburt eines Kindes oft ganz anders. Sobald das Familienleben beginnt, setzen sich alte, tief verankerte Muster durch – nicht aus bösem Willen, sondern weil sie im Körper gespeichert sind.
Winter spricht von „verleiblichten Gesten“. Gemeint sind Verhaltensweisen, die man nicht bewusst auswählt, sondern die man ist – weil man sie seit der Kindheit verinnerlicht hat. „Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein“ – allein in diesem Lied steckt die Chiffre: Der Mann entdeckt die Welt, ist ungebunden. Die Frau bleibt zu Hause.
Diese Muster schlafen im Alltag des kinderlosen Erwachsenenlebens oft unbemerkt – sie werden erst durch die Atmosphäre des „Elternseins“ wieder wachgerufen. Plötzlich erlebt sich die Frau wieder als „klassische Mutter“, obwohl sie das nie wollte. Und der Mann als derjenige, der lieber das Fahrrad repariert oder den Rasen mäht, als drinnen Windeln zu wechseln, Arzttermine zu übernehmen oder Babyklamotten zu besorgen – obwohl er es besser weiß.
Das falsche Gefühl
Diese Reaktivierung überkommener Rollen passiert unbewusst. Und das ist der Knackpunkt: Die Gleichberechtigung scheitert nicht an Einsicht, sondern am Gefühl. An dem Gefühl, dass „es sich eben richtig anfühlt“, wenn die Frau sich kümmert. Und an der Müdigkeit, die entsteht, wenn man sich gegen dieses Gefühl stemmen muss. Veränderung ist möglich – aber sie erfordert bewusste Kraft gegen das, was sich unbewusst richtig anfühlt. Gegen das Vertraute. Nicht selten: gegen die Bilder der eigenen Kindheit.
Rollengefängnis mit Blumen
Das ist das Dilemma des Muttertags: die inszenierte Anerkennung einer Rolle, deren Grenzen nicht verlassen werden dürfen. Die Identität von Frau und Mutter wird nicht nur gefeiert – sie wird einzementiert. Mütter bekommen Blumen, die die Stäbe ihres gesellschaftlichen Rollengefängnisses schmücken sollen.
Und das hat Folgen. Frauen, die ausbrechen wollen und auf die Unwucht hinweisen, gelten schnell als kontrollierend, übergriffig, unzufrieden. Nicht selten eskaliert das – und am Ende stehen Vorwürfe, Rückzüge, Trennungsandrohungen. Denn viele Männer, so Winter, sind unbewusst ständig auf dem Sprung. Die Mutter dagegen hält aus. Weil sie unter den gegebenen gesellschaftlichen Umständen nahezu keine Wahl hat. Oder nur eine, die das Leben noch schwerer macht.
Loslassen, um anzupacken
Deshalb sollten Väter, die ihre Partnerinnen aufrichtig lieben, aufhören, sich zu rechtfertigen, warum sie dies oder jenes nicht getan haben. Warum sie dies und jenes nicht gesehen haben. Sie sollten aufhören zu fragen, was zu tun ist – und stattdessen reflektieren, warum sie es nicht ohnehin schon getan haben.
Väter sollten in sich gehen – und dann mit den Kindern allein in den Urlaub. Ohne die eigene Mutter im Gepäck. Sie sollten ermöglichen, dass ihre Frauen mit Freunden verreisen, dass sie regelmäßig ausgehen, an Wochenenden frei haben. Und wenn es finanziell möglich ist, sollten sie auf die eigene Zeitressourcen fressende Karriere verzichten. Väter sollten loslassen, um anzupacken. Nicht nur am Muttertag. Sondern jeden verdammten Tag. Davon profitieren am Ende auch die Kinder.