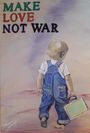Genau vier Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht - am 8. Mai 1949 - beschloss der Parlamentarische Rat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das Datum war bewusst gewählt worden, nach heftigen Debatten und zahlreichen Änderungen drängte der Präsident des Rates, der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer, kurz vor Mitternacht auf eine Abstimmung. Mit 53 Ja-Stimmen (die Abgeordneten der KPD, der Deutschen Partei, der Zentrumspartei und einige der CSU stimmten dagegen) wurde die Verfassung angenommen.
Die Deutschen wollten keinen Weststaat
Neun Monate hatte der Parlamentarische Rat im Vorfeld über die neue provisorische Verfassung für die westdeutschen Länder beraten. Die Initiative zur Gründung eines westdeutschen Staates ging von den Alliierten aus. Auf der Londoner Sechsmächtekonferenz, an der neben den Besatzungsmächten auch die Beneluxstaaten teilnahmen, wurde der Auftrag, die Gründung eines demokratischen, föderalistischen Staates vorzubereiten, an die Ministerpräsidenten der Trizone formuliert. Die sogenannten Frankfurter Dokumente, die später an die Verantwortlichen in der deutschen Politik übergeben wurden, waren umstritten: Frankreich hätte am liebsten nie wieder einen deutschen Staat gesehen, konnte sich mit dieser Position aber nicht durchsetzen und schloss sich letztendlich der Forderung der Vereinigten Staaten an. Ein föderaler Staat mit weitreichenden Kompetenzen der Länder sollte es werden - den Schrecken von zu viel Macht in wenigen (deutschen) Händen wollte man in Europa nie wieder erleben.
Die deutsche Politik war von ihrem neuen Arbeitsauftrag zunächst gar nicht begeistert: Man befürchtete - nicht gänzlich zu Unrecht - die sich abzeichnende Teilung Deutschlands weiter voranzutreiben und Schwarz auf Weiß für die Ewigkeit festzuhalten, sollte man sich eine Verfassung geben. Auf der Sechsmächtekonferenz war einerseits betont worden, der westdeutsche Staat solle einer späteren gesamtdeutschen Lösung nicht im Wege stehen. Andererseits hatte die Sowjetunion an der Konferenz schon nicht mehr teilgenommen. Auch die ostdeutschen Ministerpräsidenten wurden im Juli 1948 gar nicht erst nach Koblenz eingeladen. Dort trafen sich die westdeutschen Regierungschefs, um die Frankfurter Dokumente zu besprechen. Nach anfänglichem Widerstand stimmte die deutsche Politik unter einigen Vorbehalten zu.
Ein Provisorium mit Ewigkeitsgarantie
Die Ministerpräsidenten erklärten sich bereit, eine Verfassung zu erarbeiten - wollten diese aber nicht so nennen. Der Gedanke schien zu endgültig. Es sollte bei einem Provisorium bleiben, den Begriff „Grundgesetz“ hatte Hamburgs Bürgermeister Max Brauer vorgeschlagen. Vor einer verfassungsgebenden Versammlung scheuten sich die Regierungschefs ebenso, deshalb wurde ein „Parlamentarischer Rat“ gewählt. Aus dem selben Grund wurde eine Volksabstimmung, die von den Militärgouverneuren (darunter der Namensgeber der Garlstedter Kaserne Lucius D. Clay) eigentlich gefordert war, abgelehnt. Was auch immer in Westdeutschland beschlossen werden würde - sei es durch den Souverän oder gewählte Vertreter -, könne ohnehin nicht für das gesamte deutsche Volk gelten.
Mit diesen Einschränkungen, die von den Besatzungsmächten schließlich akzeptiert wurden, machten sich ursprünglich 65 von den Landtagen gewählte Mitglieder im Parlamentarischen Rat im September 1948 an die Arbeit und schufen mit dem Grundgesetz eine einzigartige Verfassung. Viele der Abgeordneten waren vom Nazi-Regime verfolgt worden, einige waren allerdings auch Profiteure gewesen oder gar selbst in Verbrechen verwickelt. Individuelle Rechte und Freiheiten sollten in der Verfassung eine besondere Stellung haben und wurden mit dem berühmten Artikel 1 allen anderen vorangestellt - anders als etwa in der Paulskirchenverfassung von 1849, die in Teilen als Vorbild galt. Obwohl das gesamte Dokument als vorläufig betrachtet wurde, beschlossen die 61 Väter und vier Mütter des Grundgesetzes, dass an den wichtigsten Grundsätzen nicht mehr gerüttelt werden darf: Ausgerechnet die provisorische Verfassung enthält mit Art. 79 Abs. 3 die sogenannte Ewigkeitsklausel. Änderungen an den Artikeln 1 bis 20 - die Grundrechte und Prinzipien des demokratischen Rechtsstaates - sowie Versuche, die föderale Struktur und die Kompetenzen der Bundesländer anzutasten, sind demnach nicht erlaubt. Andere Änderungen am Grundgesetz können mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag beschlossen werden.
Wehrhafte Demokratie
Die wichtigsten Prinzipien der ersten 20 Artikel unter Schutz zu stellen sollte verhindern, dass die Demokratie erneut ausgehöhlt werden könnte, wie es in der Weimarer Republik geschehen war. Zu diesem Zweck wurde auch das im internationalen Vergleich außergewöhnlich starke Bundesverfassungsgericht geschaffen. Das Gericht kann in unterschiedlichen Verfahren Entscheidungen der Regierung oder des Parlaments für nichtig erklären, wenn sie seiner Auffassung nach gegen die Verfassung verstoßen. Mit einer Vielzahl prominenter Beschlüsse hat das Gericht in der 75-jährigen Geschichte der Bundesrepublik die Politik maßgeblich beeinflusst. Das konstruktive Misstrauensvotum reiht sich ebenfalls in die Lehren aus Weimar ein. Der Bundestag kann eine Regierung nur absetzen, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten dafür stimmen und gleichzeitig einen neuen Bundeskanzler wählen. Eine Mehrheit ohne gemeinsamen Regierungswillen kann die Exekutive also nicht blockieren.
Die Wiedervereinigung
Neben den unveränderlichen Rechten und Prinzipien enthält das Grundgesetz zahlreiche Bestimmungen über die Funktionsweise des Staates und die Zuständigkeiten seiner Organe - sozusagen ein Handbuch der Bundesrepublik. Darüber hinaus wurde die deutsche Wiedervereinigung als klares Ziel niedergeschrieben. Der letzte Satz der ursprünglichen Präambel lautete: „Das gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.“
Zwei Möglichkeiten wurden dafür im Text festgehalten. Nach dem historischen Art. 23 (der „Beitrittsartikel“) gilt das Grundgesetz in den westdeutschen Bundesländern, in „anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen“. Bekanntlich war dies der Weg, für den die Volkskammer der DDR im August 1990 stimmte. Unter Verfassungsrechtlern wurde die Frage, ob die DDR dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beitreten solle, kontrovers diskutiert. Es hätte nämlich auch einen anderen Weg gegeben: Nach Art. 146 (der bis heute besteht) verliert das Grundgesetz „seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist“. Mit dem Beitritt sei der Osten „überrollt“ wurden, meinen Kritiker bis heute und halten an der Überzeugung fest, es hätte eine neue Verfassung geben müssen. Pragmatiker führen an, die Gunst der Stunde, in der sowohl die USA als auch Russland die Wiedervereinigung befürworteten, habe man damals nutzen müssen. Sie sticheln, eine neue Verfassung für den gesamtdeutschen Staat wäre vielleicht bis heute nicht fertiggestellt worden.
Nein zum Volksentscheid
Nach der Wiedervereinigung wurde eine Kommission eingesetzt, die das Grundgesetz auf Änderungsbedarf überprüfen sollte. Dabei ging es auch um die Frage, ob das Grundgesetz in einer Volksabstimmung bestätigt werden müsse. Anders als noch in der Nachkriegszeit habe das deutsche Volk inzwischen ein demokratisches Selbstverständnis entwickelt, argumentierten Befürworter - dafür sei die friedliche Revolution in der DDR ein gelungenes Beispiel. Nach dem Prinzip der parlamentarischen Demokratie sei das Grundgesetz bereits legitimiert, lauteten die Gegenstimmen. Ein Plebiszit könne dem nichts hinzufügen. Weiterhin seien Volksabstimmungen in einer pluralistischen Demokratie schwierig - schließlich brauche es Kompromisse statt einfachen Ja-Nein-Entscheidungen. Eine adäquate politische Willensbildung könne nur der parlamentarische Gesetzgebungsprozess garantieren.
Den Verzicht auf einen Volksentscheid - der auch als Gegenmittel zur Entfremdung und Politikverdrossenheit gesehen wird - bezeichnen Kritiker bis heute als schweren Fehler und machen ihn für problematische Entwicklungen, vor allem in den „neuen“ Bundesländern, verantwortlich. „Hätte es ein Plebiszit nach der deutschen Einheit gegeben, dann gäbe es vielleicht keine AfD“, sagt beispielsweise der Jurist und Journalist Heribert Prantl.
Bayern lehnt ab
Der offizielle Tag des Grundgesetzes ist der 23. Mai 1949. Mit den Worten „Heute wird die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten“ verkündete Konrad Adenauer das Inkrafttreten der neuen Verfassung, die ab Mitternacht gelten sollte. Nach der Abstimmung im Parlamentarischen Rat mussten noch die Militärgouverneure und die Landtage der Bundesländer die Verfassung annehmen. Außer dem bayerischen Landtag stimmten alle zu. Der Freistaat hatte jedoch erklärt, die Verbindlichkeit des Grundgesetzes anzuerkennen, insofern die erforderlichen zwei Drittel aller Bundesländer es annehmen sollten. Damit war der Weg frei für die provisorische Verfassung, bis heute gilt.