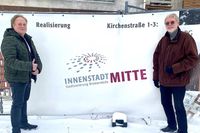Es ist 1996. Ich war damals elf und meine „bildungsarmen“, sprich nicht-akademischen Eltern waren bezüglich Süßigkeiten, Cola und Fritten genauso so entspannt wie der Beat des damaligen Radiohits Jein von Fettes Brot aus demselben Jahr.
So konnte ich am Wochenende, von meinen ausschlafenden Eltern unbehelligt, noch vorm Frühstück genüsslich den ein oder anderen Milky Way verdrücken. Und unter der Woche verputzte ich beim nachmittäglichen Spielen gut und gerne eine Packung Chips oder 200 Weingummi-Schuhe. Kosteten ja nur 2 Pfennig das Stück.
Diese liebevolle Gelassenheit meiner Eltern, in Zucker nicht kurzkettige Kohlenhydratnazis zu sehen, die meine Gesundheit und damit meine Zukunft vernichteten, lag aber nicht an ihrem jungen Alter oder an ihrer vermeintlichen Unwissenheit. Ihr Verhalten war Ausdruck einer Zeit, in der Gesundheit bzw. ihre Missachtung auf der einen Seite noch Privatsache und der Staat auf der anderen noch ein sozialer war. Als man noch nicht von „Fordern und Fördern“ sprach, aber Flexibilität statt Kündigungsschutz oder Fitnessstudio statt Krankenkasse meinte. Als der Staat seinen Bürger:innen also noch vollumfänglich Sozial- und Krankenkassenleistungen erbrachte und ihnen noch nicht den Auftrag zur neoliberalen, d. h.: immense Staatskosten sparenden „Selbstverantwortlichkeit“ zum Erhalt ihrer Arbeit und Gesundheit aufgezwungen hatte.
Denn mit der Deregulierung des Marktes und der Aufweichung des Kündigungsschutzes auf der einen und der Streichung von Krankenkassenleistungen auf der anderen Seite; also mit Angst vor Arbeitslosigkeit und Krankheit hatte man begonnen, dem - wie man Menschen seither nonchalant nennt - „Humankapital“ buchstäblich Beine zu machen. Für den Standtort raus aus abgesicherten Arbeitsverhältnissen und rein in die Muckibude. Denn nur eine gesunde Arbeitskraft ist eine flexible und produktive Arbeitskraft.
Mit dieser Mobilisierung hatten ironischerweise SPD und Grüne seit den 2000ern mit ihrer Gesundheitsreform als Teil der Agenda 2010 zur Stärkung des Standorts Deutschland begonnen, mit der sie sich in die weltweite Sozialstaatsabbau-Bewegung einreihten.
Mit dieser Politik hatte man nicht nur die Vorstellung erzeugt, Gesundheit verspreche Erfolg am Arbeitsmarkt und umgekehrt. Konsequenterweise hatte man auch begonnen, nicht nur Armut, sondern auch Krankheit als individuelles Scheitern zu betrachten. Das seither unbedingt selbstverantwortlich mit Fitness, Brokkoli und Verzicht auf zweckfreien Genuss verhindert werden muss. Aber weil der Körper nie eindeutig widerspiegelt, dass es ihm wirklich gut geht, weiß man im Grunde nie, ob man sich genug für die Gesundheit und damit für den Erfolg am Arbeitsmarkt abstrampelt und verbietet. Auch der Fitteste kann jederzeit schlimm erkranken oder beim Joggen tot umfallen.
Dieses gesellschaftliche Survival of the Fittest übt natürlich immensen Druck aus und versetzt die Menschen in eine mal mehr, mal weniger bewusste Überforderung und Panik. Beides drückt sich nicht nur in der Rede von Gesundheits- und Fitnesswahn in den Medien aus, sondern schlägt sich in verschiedenen Milieus in unterschiedlichen Verhaltensweisen nieder. Bei jenen, denen ein Aufstieg in der Gesellschaft eh als versperrt erscheint, als die auto-aggressive Verweigerungshaltung, mehr Chips als frisches Gemüse zu essen. Denn die Verächtlichkeit, mit der die Gesellschaft auf die Abgehängten blickt, verlängert sich in ihnen zu einem ambivalenten Verhältnis zu sich selbst. Einerseits sind sie sich die Arbeit, die ein gesundes Leben erfordert, nicht wert. Denn Selbstwert hängt in unserer Gesellschaft an Erfolg. Andrerseits beziehen sie aus der Rebellion gegen die gesellschaftliche Aufforderung zu einem gesunden Leben einen Ersatz-Selbstwert abseits von Gesundheit und Karriere.
Und bei sportiv aufgemotzten Mittelstandseltern, die noch an das Karrieregame und dessen Segnungen glauben, übersetzt sich ihre Gesundheitspanik in das passiv-aggressive Verhalten ihren Kindern gegenüber, sie mit einem Reformhausbonbon zu belohnen, wenn sie ihren Broccoli-Chia-Samen-Smoothie getrunken haben.
Es soll hier nicht darum gehen, das Verhalten meiner Eltern als ein richtiges zu verklären. Wer weiß, vielleicht bringen mich die Gummischuhe ja noch um, obwohl mein BMI auf Staatslinie ist. Aber von ihrer damaligen Gelassenheit könnte man sich insofern etwas abschneiden, als dass man im Kopf neben den Körnereinkaufszetteln etwas Platz für folgende Gedanken findet: Dass individuelle Gesundheit in unserer flexibilisierten Gesellschaft zu der unverzichtbaren Voraussetzung wurde, um auf dem deregulierten Arbeitsmarkt nicht unterzugehen. Und Gesundheit deshalb nicht mehr das Leibeswohl des Einzelnen, sondern den Modus seines modernen Funktionierens bezeichnet. Und das dieser Modus nicht gesund, sondern erschöpfend ist, davon haben mittlerweile alle eine dumpfe Ahnung.
Deshalb ist zum einen schlechte Ernährung bei „bildungsarmen Familien“ auch nicht Ausdruck von Unwissen. Es ist Ausdruck eines spezifischen Leids, das der ökonomisch notwendig gewordene Gesundheitswahn unter jenen verursacht, denen diese Gesellschaft die Sprossen auf der Karriereleiter sichtbar an- bzw. ausgesägt hat. Und zum anderen sind Forderungen wie das Verbot von Kindermarketing z. B. bei Haribo nicht Ausdruck von Sorge um unsere Kinder, sondern ein gesundheitspolitischer Angriff auf ihre Kindheit.
Denn solche Kampagnen stacheln in erster Linie die Gesundheitspanik unter Eltern an. Damit sie ihre eigene als Selfcare getarnte, aber in Wirklichkeit durch Angst in Gang gesetzte Produktivierung ihrer Selbst für den Arbeitsmarkt so früh wie möglich ihren Kindern antun. Damit der Nachwuchs sich der Welt so widerstandsarm wie möglich einfügt. Hierzu treibt man ihm jede kindliche Lust am zweckfreien Genuss aus. Den bereitet nämlich nicht nur Spielen, sondern eine Tüte Gummibären dabei. Gerade weil sie zu futtern nicht auf Gesundheit, sondern lediglich auf die sinnlos-schöne Freude am Geschmack zielt. Gerät diese Weingummitüte aber zum einzigen Inhalt eines jeden Tages, wird auch sie – wie andererseits der Gesundheitsdrill unter Erwachsenen – zum bloßen Mittel, die Freudlosigkeit des eigen Lebens zu betäuben.
6. März, überarbeitete und ausführlichere Version der Printvariante