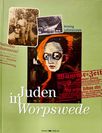Wenn in Europa am Morgen die Kaffeemaschine gluckst, denkt kaum jemand an El Salvador. Doch im kleinsten Land Mittelamerikas wurde der Kaffee über Jahrzehnte zur Lebensader der Wirtschaft – und zugleich zum Treibstoff eines der blutigsten Bürgerkriege des 20. Jahrhunderts. Zwischen 1979 und 1992 starben mehr als 70.000 Menschen. Der Kaffee war dabei nicht nur Handelsware, sondern Symbol und Schauplatz eines erbitterten Klassenkampfes.
Klassenkampf und Kaffeeoligarchie
Seit dem späten 19. Jahrhundert kontrollierte eine Oligarchie, bekannt als die „Vierzehn Familien“, nahezu das gesamte wirtschaftliche Leben El Salvadors. Familien wie die Dueñas oder die Hill stiegen mit riesigen Plantagen und Exportgeschäften auf. Ihr Reichtum beruhte auf dem ausbeuterischen Anbau von Kaffee, ihr Einfluss reichte bis in die Präsidentenpaläste und Generalskasernen. Mit den Exporterlösen finanzierten sie Banken, Handelsgesellschaften und ein politisches System, das ihre Macht absicherte.
Die salvadorische Kaffeeproduktion war ein damit ein Rahmen, in dem sich die sozialen Gegensätze des Landes kristallisierten. Landarbeiter schufteten auf den Plantagen für Hungerlöhne, während die Erlöse in die Taschen weniger Großgrundbesitzer flossen. Wer mehr forderte – Land, Lohn, Rechte – riskierte Repression. Dennoch formierte sich Widerstand in den 1920er Jahren.
La Matanza und der Kalte Krieg
Eine Schlüsselfigur war Agustín Farabundo Martí, ein marxistischer Aktivist und Sozialreformer. Er kämpfte für Landrechte, soziale Gerechtigkeit und die Rechte der indigenen Bevölkerung. 1932 führte er einen Aufstand der Landarbeiter an, die sich gegen das Kaffeeregime erhoben. Der Aufstand wurde vom Militär brutal niedergeschlagen, 10.000 bis 30.000 Menschen wurden ermordet – ein Massaker, das als „La Matanza“ in die Geschichte einging. Martí selbst wurde hingerichtet, sein Name blieb Symbol des Widerstands, der vorerst gebrochen war.
Vier Jahrzehnte später - in den 1970er-Jahren – verschärften sich die Klassengegensätze erneut – diesmal im Rahmen der globalen Polarisierung des Kalten Krieges. Während die USA in Mittelamerika jede linke Bewegung als kommunistische Bedrohung sahen und sie direkt und indirekt bekämpften, wuchsen hier Armut und Ungleichheit unerträglich an. Die Landbevölkerung war politisch und ökonomisch ausgeschlossen, die Gewerkschaften wurden verfolgt. Gleichzeitig verschärften fallende Kaffeepreise die soziale Not. Die Gegensätze zwischen Landarbeitern und Großgrundbesitzern explodierten. Internationale Kaffeeabkommen, die eigentlich Preisstabilität sichern sollten, wirkten in El Salvador wie ein Brandbeschleuniger. Die Exporterlöse flossen nicht in Schulen oder Krankenhäuser, sondern in Militärbudgets und private Sicherheitsdienste. Während der Westen in den 1980er-Jahren also seine Kaffeemaschinen mit salvadorianischen Bohnen füllte, wurden mit dem Erlös Waffen gekauft und gegen jene eingesetzt, die sie anbauten – dass sie ohne Aufmucken und Perspektive schufteten.
Todesschwadronen der Kaffeebohnen
Zur Bündelung ihrer Kräfte schlossen sich verschiedene linke Guerillagruppen 1980 schließlich zur FMLN zusammen – zur Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Benannt nach dem Märtyrer von 1932 kämpfte sie für eine Landreform, für politische Beteiligung der Massen und für die Zerschlagung der Oligarchie. Auf der Gegenseite stand das Militärregime, unterstützt von den USA, die jährlich Millionen Dollar an Militärhilfe lieferten.
Die Frontlinien verliefen mitten durch die Kaffeeregionen. Guerilleros kassierten Abgaben auf Plantagen oder brannten Felder nieder, um die Oligarchie zu schwächen. Die Großgrundbesitzer reagierten mit paramilitärischen Todesschwadronen, die Arbeiter, Priester und Oppositionelle ermordeten. Berühmt wurde das Schicksal von Óscar Romero, Erzbischof von San Salvador. Er prangerte die Gewalt der Militärs an und stellte sich offen auf die Seite der Armen. 1980 wurde er während einer Messe erschossen – ein Mord, der weltweit Empörung auslöste, aber den Krieg nicht beendete.
Genuss und Gewalt
Erst 1992 kam es mit dem Friedensabkommen von Chapultepec zum Ende der Kämpfe. Einen klaren Sieger gab es nicht. Das Militär und die Oligarchie konnten die Guerilla nicht zerschlagen, die FMLN wiederum erreichte keinen militärischen Sieg. Beide Seiten gaben auf – erschöpft, international unter Druck und konfrontiert mit einem Land in Trümmern. Die FMLN wandelte sich in eine Partei, ehemalige Rebellen saßen nun im Parlament. Doch die strukturellen Probleme – Landverteilung, Armut, Gewalt – blieben bestehen.
Der Kaffeekrieg El Salvadors lehrt, dass Genuss und Gewalt in einer zum - Profit abwerfenden - Verkauf Waren produzierenden Welt nicht zufällig verknüpft sind. Der bittere Geschmack der Gewalt steckt in der Logik der Ware selbst: Damit im Norden billiger Genuss d.h. Massenexport möglich war, mussten im Süden Arbeiter unterdrückt und ausgebeutet werden. Was dem Plantagenbesitzer die Tasse Kaffee versüßte – der Profit – trug für jene, die für ihn schufteten, das Aroma von Hunger, Repression und Tod.