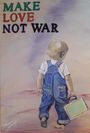Worpswede. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Die Welt wurde durch die vollständige Kapitulation der deutschen Wehrmacht vom nationalsozialistischen Terror befreit, die Deutschen besiegt.
Zum 80. Jahrestag dieses Ereignisses hatte das Worpsweder Bündnis „Nie wieder – Erinnern für die Zukunft – Gemeinsam gegen Rechts“ zu einer Gedenkveranstaltung auf den „Rosa-Abraham-Platz“ eingeladen. Rund sechzig Frauen und Männer waren dem Aufruf gefolgt. Der Tod von Margot Friedländer einen Tag nach der Gedenkfeier zeigt, wie wichtig diese Art von Erinnerungskultur ist. Denn mit der über alle Grenzen bekannten Holocaust-Überlebenden starb mit 103 Jahren eine der größten Mahnerinnen, die sich bis zuletzt als Zeitzeugin dafür engagiert hatte, die Erinnerung an die NS-Verbrechen wachzuhalten.
In ihrer Einladung zu der Veranstaltung hatte die Initiative geschrieben: „Mit der Aufrechterhaltung des Gedenkens zeigen wir, dass wir aus unserer Vergangenheit gelernt haben – „Brandmauern“ dürfen nicht niedergerissen, „rote Linien“ nicht überschritten und extrem rechte Parteien nicht zu „normaler Opposition“ im Bundestag bagatellisiert werden.“
Eine Stunde Null hat es nicht gegeben
Hauptthema des Abends war die sogenannte „Stunde Null“ nach Kriegsende. Dr. Bernd Moldenhauer berichtete in seinem Vortrag „Justiz und Polizei – Die Entnazifizierung als vertane Chance“ über die juristische Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen und resümierte, dass diese absolut unvollständig geblieben sei. Nur ein sehr kleiner Teil der Verbrecher habe sich vor Gericht verantworten müssen und viele hätten ihre Haftstrafen nicht vollständig abgesessen. Eine „Stunde Null“ habe es nicht gegeben und die behauptete Entnazifizierung sei nur vordergründig gewesen. „Rassistische und antisemitische Einstellungen sind bis heute und mehr denn je in der Gesellschaft und nicht zuletzt in den Sicherheitsbehörden wie der Polizei weit verbreitet. Erinnerungskultur darf deshalb nicht dabei stehen bleiben, an die Vergangenheit zu erinnern und die vermeintliche Versöhnung mit den Opfern und ihren Nachkommen zu beschwören. Wir sind heute dafür verantwortlich, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt“, so Moldenhauer.
Zuvor hatten weitere Mitglieder der Initiative aus Saul Padovers Buch „Lügendetektor“ einzelne Abschnitte gelesen. Der Oberstleutnant aus der Abteilung „Psychologische Kriegsführung“ der US-Army hatte in den Jahren 1944/45 die deutsche Bevölkerung interviewt, um deren Stimmung und Lage zu verstehen. Er führte Gespräche mit Menschen aller Schichten und erstellte ein Stimmungs- und Situationsbild der Bevölkerung im Angesicht der Niederlage. Sein Buch gilt als ein authentisches Dokument aus jener Zeit, als der Krieg verloren und doch noch nicht zu Ende war.
Gedenkort geplant
Im Rahmen der Gedenkveranstaltung stellte Barbara Millies von der Arbeitsgruppe „Aufarbeitung der NS-Zeit in Worpswede“ die Idee für einen Gedenkort an die im Nationalsozialismus ermordeten Menschen aus Worpswede vor. Da Stolpersteine im Künstlerort aus praktischen Gründen nicht möglich seien, sollen nach den Vorstellungen der Initiatoren nach Absprache mit Bürgermeister Stefan Schwenke zwei Stelen aus hellgrauem Granit vor dem Rathaus als Gedenkstätte entstehen. Nach bisherigen Recherchen sind aktuell die Namen von zwanzig Personen, die in Worpswede während der NS-Zeit ermordet oder in den Tod getrieben wurden, identifiziert worden. Für die Umsetzung des geplanten Projekts wurden am 8. Mai am Ende der Versammlung Spendenbeiträge gesammelt.