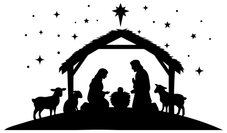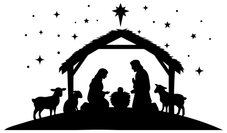
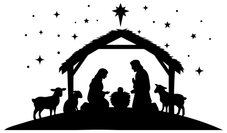
Das Leben des Bildhauers und Architekten Bernhard Hoetger ergibt eine der interessanteren Künstlerbiografien. Der Welt und ihren Symbolwelten gegenüber sehr offen, handwerklich hochbegabt und vom Expressionismus geprägt, und mit Stationen in Paris, Darmstadt, Worpswede, Fischerhude und Bremen, mit einer sich immer wieder wandelnden, aber konstant verballerten Esoterik-Philosophie im Gepäck. Um dann in den letzten zehn Jahren einen in Schlenker ins Völkische zu unternehmen.
Authentische Großkünstler
Der Film „Bernhard Hoetger - Zwischen den Welten“ ist einfach deswegen gelungen, weil man sich schon sehr anstrengen müsste, um so eine Biografie auf der Leinwand fade werden zu lassen.
Leider ist er davon abgesehen formal eher missglückt. Das Mischformat der Dokufiction, das Schauspielerszenen, die Anspruch auf Authentizität erheben, mit dokumentarischen Bildern, die Anspruch auf Authentizität erheben, und Experten-Interviews, die Anspruch auf Authentizität erheben, aneinander montiert, ist ein verfluchtes.
„Berhard Hoetger“ treibt das ganze auf die Spitze, in dem der Film ohne erkennbares Gespür für das Camp-Potenzial seiner Bilder schon vor ein paar Jahren Verstorbene von Schauspielern spielen lässt, die als Zeitzeugen verkleidet in Talking-Head-Interviews auftreten. So dass dann etwa Arie Hartog, der noch sehr lebendige Leiter des Gerhard-Marcks-Hauses, im Anschluss an den von Florian Lukas gespielten Heinrich Vogeler interviewt wird.
Hinzukommt, dass der Duktus ein sehr getragener ist, stärker noch als im deutschen pädagogisch wertvollen Kino ansonsten eh schon. Jeder Satz ist perfekt prononciert, jedes G und jedes T klingen wie einzeln ausgesprochen. Alle Schauspielerinnen und Schauspieler in diesem Film spielen und, vor allem, sprechen, als stünden sie auf einer Theaterbühne. Wie da der Großkünstler (Moritz Fu¨hrmann) mit Stirnfalte und zerquältem Gesicht Künstlersätze aufsagt („Diese Stadt hier ist so klein, wie soll ich hier die Anregungen finden, die ich für meine neuen Aufgaben brauche?“) - das hat schon was von einem Film gewordenen Volkshochschulkurs und ist in seiner Stahlförmigkeit dann auch wieder ganz bezaubernd.
Drängende Schaffenskraft
Aber trotzdem, wie gesagt, langweilen tut man sich nicht, wenn man Interesse an Kunst und/oder Quatschphilosophie mitbringt. Hoetgers Denken war über viele Jahre scheint‘s ein sehr offenes. Es bezog sich auf Buddhismus, die Kunst des ägyptischen Altertums, auf indische Philosophie und am Ende eben auf ungebrochen völkische Ideologie. Die Klammer, die all diese mannigfaltigen Einflüsse zusammenhält, wird vom Selbstbild eines Großkünstlers gebildet, dessen Leben (wie auch das Leben aller anderen um ihn herum) sich dem Werk unterzuordnen hat. In einer Szene sitzt Hoetger mit Vogeler im Moorschlamm und fühlt sich angeregt von der Landschaft: „Ich spüre, wie es aus mir drängt voller Schaffenskraft.“ Vogeler erzählt was von seinen Eheproblemen, aber das Alltägliche ist Hoetgers Sache nicht: „Die Aufgabe des Künstlers ist doch die des Schöpfers. Den tieferen Geist der Materie, das Bewegende im All, ach die Allweisheit selbst zu gestalten.“ Drunter macht er es nicht.
Nazis wollten ihn nicht
Und trotzdem ging es im letzten Drittel dieses Lebens nach ganz tief unten. Ein paar Jahre später drängte es Hoetgers Schaffenskraft weg von der Allweisheit und stattdessen in Richtung Volkskunst. Das Völkische wollte Hoetger durch seine Kunst nach der krachenden Niederlage Deutschlands im 1. Weltkrieg reanimiert sehen und fabuliert etwas von „nordischer Kultur“ und „Atlantis“. Das hauptsächliche Resultat, die vom letzten Mäzen seines Lebens, dem Bremer Kaffeesack und Erzreaktionär Ludwig Roselius durchfinanzierte Böttcherstraße ist wirklich sehr hübsch, und heute kann man dort sehr schön Kohl-und-Pinkel essen, das Paula-Modersohn-Becker-Museum besuchen oder ins Kino gehen.
Hoetger hatte eine „moderne nordische Kultur“ im Sinn, dargebracht, um sich vom „falsch angebrachten griechischen Geist“ zu befreien. Stattdessen sollte „germanisches Empfinden“ Einzug halten in die Köpfe und Herzen. Die Nazis aber wussten die, so der Künstler ohne falsche Bescheidenheit, „primitive und monumentale“ Schönheit der Bauten Hoetgers nicht zu schätzen. Hitler polemisierte in einer Rede gegen die „Böttcherstraßenkunst“, Bernhard Hoetger sah zu, dass er Land gewann, und reiste in die Schweiz. Wenn man furchtbar gerne bei den Nazis mitmachen will und die wollen einen dann nicht, das ist schon ein sehr dummes deutsches Künstlerschicksal.
Keine Schublade gefunden
Arie Hartog, gewohnt stabil in politisch-ästhetischen Fragen, bringt es auf den Punkt: Hoetger sei ein Esoteriker gewesen, der zum Nationalen gefunden hätte. Mit den Nazis geteilt hätte er die Vorstellung einer nationalen Erhebung und den Antisemitismus. Und tatsächlich hält der Film in dieser Hinsicht nicht hinterm Berg: Das weihevolle, von sich selbst berauschte Geraune über das Arische, das Germanische, das Atlantische und Wurzelige, es zerrt einem beim Sehen schon hart an den Nerven.
Um die den Expressionismus hassenden Parteigenossen doch noch von der Güte dessen, was er unter nordischer Kunst verstand, zu überzeugen, hievte Hoetger den Lichtbringer an den Eingang der Böttcherstraße. Und da hängt er heute noch, und das recht prachtvoll, muss man sagen. Aber genügt hat es nicht, und der Künstler wurde mitsamt seiner späten Wurzelkunst aus der Partei ausgeschlossen.
Allerdings verwahrt Hartog sich dagegen, Hoetger in eine Schublade zu packen und die dann zuzumachen. Vielmehr sei hier ein Künstler sein Leben lang zwischen Schubladen hin und her gesprungen. Und tatsächlich sind die Bauten und Skulpturen, die Bernhard Hoetger zum Beispiel über Worpswede verteilt hat, sehr lebendige Gebilde und erfreulich anzuschauen. Vom völkisch-drohend auf das Dorf hinabblickenden Niedersachsenstein einmal abgesehen. Der Untertitel „Zwischen den Welten“ trifft es gut: Richtig passend war Hoetger nie, und eben so sehr Einzelgänger, dass das nationale Kollektiv, trotz heftigen Avancen von Künstlerseite, mit ihm nichts anzufangen wusste. Alles das wird von der Regisseurin Gabriele Rose sehr umfassend und streng chronologisch nacherzählt. Man hätte ihrem Film allerdings einen etwas weniger naiven dokumentarischen Inszenierungsmodus gewünscht.